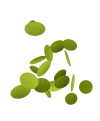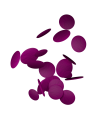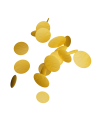Saisonschwerpunkt
Johannes Brahms
Die Heidelberger Frühling Festivalsaison 2024 widmet sich einer der bedeutendsten Komponistenpersönlichkeiten: Johannes Brahms.
Vom Streichquartettfest im Januar über das Musikfestival im März und April bis hin zum Liedfestival im Juni erlebt das Publikum eine intensive Auseinandersetzung mit Johannes Brahms' Musik. Ein Fokus liegt dabei auf der Aufführung des gesamten Kammermusik- und Soloklavierwerks. Die perspektivenreiche Werkschau wird ergänzt durch Orgel- und Chorwerke, Lieder sowie das Violinkonzert. Insgesamt stehen 76 Werke und Werkgruppen von Johannes Brahms auf dem Programm.
 Zurück zur Website
Zurück zur Website